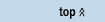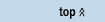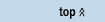"Der Seele Raum geben - Kirchen als Orte der Besinnung und Ermutigung"
"Heilige Zeichen, heilige Räume?" |
|
|
|
"Der Seele Raum geben - Kirchen als Orte der Besinnung und Ermutigung" | 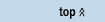 |
Unsere Kirchen dienen der christlichen Gemeinde zum Gottesdienst. Dazu sind sie gebaut. Aber sie sind mehr: Sie haben eine Ausstrahlungskraft weit über die Gemeinden hinaus, denen sie gehören.
Wer eine Kirche aufsucht, betritt einen Raum, der für eine andere Welt steht. Ob man das Heilige sucht, ob man Segen und Gottesnähe sucht oder schlicht Ruhe, ob ästhetische Motive im Vordergrund stehen - immer spricht der Raum: Durch seine Architektur, seine Geschichte, seine Kunst, seine Liturgie. Kirchen sind Orte, die Sinn eröffnen und zum Leben helfen können. Sie sind Räume, die Glauben symbolisieren, Erinnerungen wach halten, Zukunft denkbar werden lassen, Beziehungen ermöglichen: zu uns selbst, zu unserer Welt, zu Gott.
Die Synode der Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) beriet über die Bedeutung der Kirchenräume für das Leben der Menschen heute. Sie stellt sich damit ihrer gesamtgesellschaftlichen Verantwortung. Sie knüpft an die Leipziger Erklärung des 24. Evangelischen Kirchbautags vom 31. Oktober bis 3. November 2002 an: "Nehmt eure Kirche wahr!"
1. Ich habe lieb die Stätte deines Hauses (Psalm 26, 8)
Dazu müssen Kirchen zugänglich sein. Geöffnete Kirchen sollen Orte des Friedens und Zuflucht für Bedrückte sein. Hier kann die Seele durchatmen und Kraft schöpfen für den Alltag. Die Synode begrüßt, dass evangelische Kirchen zunehmend auch außerhalb der Gottesdienstzeiten offengehalten werden. Sie bittet die Gemeinden, die sich dazu noch nicht entschließen konnten, diesem Beispiel zu folgen. Sicherheitsüberlegungen müssen ausreichend berücksichtigt werden. Sie dürfen aber nicht allein bestimmend sein.
Die Synode ermutigt die Gemeinden, Kirchen neu als öffentliche Räume zu begreifen, als Orte, an denen man in erster Linie, aber nicht nur, durch den Gottesdienst Vertrautem und Gewohntem, sondern auch Fremdem und Neuem begegnen kann. Das gilt für den öffentlichen Diskurs, für die Künste, für das Theater und andere Ereignisse.
Besonders in Orten mit mehreren Kirchen kommt es darauf an, jeweils spezifische Aufgaben und Möglichkeiten zu erkunden. Eine Kirche kann als City-Kirche, als Diakonie-Kirche, Jugendkirche, Musikkirche und Meditationsraum neue Akzente setzen. Der Erfahrungsaustausch hierüber muss intensiviert werden, damit gelungene Modelle von anderen um so leichter aufgegriffen werden können.
Jeder Kirchenraum kann durch überraschende, mitunter stark verfremdende Inszenierungen und Installationen neue Zugänge zum Glauben und neue Erfahrungen mit der Wirklichkeit erschließen. Kirche muss freilich immer als Gottesdienstraum erkennbar bleiben. Die Geschichte Gottes mit den Menschen, seine Rettungstaten und der Lobpreis seiner Gemeinde müssen deutlich vernehmbar bleiben.
Es ist einer Kirche anzumerken, ob in ihr eine Gemeinde lebt und dass oft schon viele Generationen dort geglaubt und gebetet, Gott gelobt oder ihm ihr Leid geklagt haben. Eine Gemeinde, die ihre Kirche nutzt und mit Leben füllt, erbringt die wirksamste Leistung zu ihrer Erhaltung. Die Gemeinden können erwarten, dass sie bei ihrer Fürsorge für ein Gotteshaus gesellschaftliche Unterstützung erfahren. Das bedeutet auch: Die ohnehin unzureichenden Mittel, die für die Denkmalpflege zur Verfügung stehen, dürfen auf keinen Fall weiter gekürzt werden.
Die Synode dankt den Gemeinden für die Anstrengungen, die sie zum Erhalt ihrer Kirchen und für die Gestaltung der Innenräume unternehmen. Sie dankt auch allen privaten Sponsoren. Wir ermutigen die Kirchengemeinden, in den Sakralgebäuden neben der Last, die sie in mancher Hinsicht darstellen, verstärkt die Chancen zu entdecken, die in ihnen stecken.
Wenn allerdings zwischen der Chance und der Last ein aussichtsloses Missverhältnis besteht, muss auch von der Möglichkeit Gebrauch gemacht werden können, eine Kirche aufzugeben. In diesem Fall soll darauf geachtet werden, dass die neue Nutzung zu der Würde, die ein Gotteshaus einmal gehabt hat und für viele Menschen behält, nicht in krassen Gegensatz gerät.
2. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind (Matthäus 18, 20)
Besonders bieten sich unsere Kirchen für musikalische Aktivitäten und Erfahrungen an. Sie sind seit jeher so ausgestattet, dass in ihnen gesungen und musiziert wird. Musik ist die Sprache, die Menschen unterschiedlicher Überzeugungen zusammenführen kann; für viele Menschen bildet sie einen einzigartigen Zugang zu Glaubenserfahrungen.
Eine erweiterte Nutzung der Kirchen für Konzerte, Ausstellungen und Versammlungen ist von der Sache her und um der hohen Erhaltungskosten willen sinnvoll. Die Veranstaltungen müssen sich jedoch mit dem Charakter eines christlichen Gotteshauses vertragen und zum Dialog mit dem Raum bereit sein. Wenn ein Kontrast entsteht, muss die Möglichkeit gegeben sein, diesen öffentlich zur Sprache zu bringen und darüber in ein Gespräch einzutreten.
Es ist eine schöne und notwendige Aufgabe, den Besuchern einer Kirche deren Funktionen, ihre Ausstattung, die Sprache ihrer Kunstschätze zu deuten und inhaltlich aufzuschließen. Darin drückt sich auch die Gastfreundlichkeit einer Kirchengemeinde aus. Wir bitten die Gemeinden, die Kirchenpädagogik und die Schulung interessierter Gemeindeglieder weiter zu fördern. Speziell im Blick auf Kinder gibt es gute Anleitungen, die noch mehr in Anspruch genommen werden sollten.
Davon unabhängig werden zunehmend Räume entdeckt, in denen sich Gemeinde in neuen Formen sammelt und präsentiert. In der Öffentlichkeit wird dies z.B. in einem Kirchenladen, bei Kunstgottesdiensten in einem Museum, durch Lichterketten und Mahnwachen an Gedenkstätten und Einsatz für Verfolgte sichtbar. Auch Gottesdienste im Freien erfreuen sich wachsender Beliebtheit. All dies ist Ausdruck des Bedürfnisses, sich als Gemeinde Jesu Christi nicht hinter Kirchenmauern zurückzuziehen.
3. Suchet der Stadt Bestes! (Jeremia 29, 7)
Oft stehen unsere Kirchen mitten im Ort. Dort gehören sie auch hin, weil die christliche Gemeinde in der Mitte der Gesellschaft ihren Ort hat - hellhörig für das, was Menschen bewegt und in ihrer Hörweite, um ihnen das Wort zu sagen, das wie die Kirchtürme auf eine andere Dimension unseres Lebens weist: das Wort Gottes.
Kirchen gehören zur Silhouette eines Dorfes, einer Stadt, das Geläut bildet die akustische Signatur. Oft gehören Kirchengebäude ausdrücklich zu den Wahrzeichen der Orte, mit denen sich ihre Einwohner identifizieren - auch solche, die nicht Kirchenmitglieder sind.
In besonderen Stunden haben sich unsere Kirchen immer wieder als Stätten gemeinsamen Empfindens, gemeinsamer Freude und Ermutigung im Leid bewährt. An den Festen des Kirchenjahres und an den freudigen und leidvollen Wendepunkten des Lebens, aber auch in krisenhaften Situationen, etwa nach dem Zugunglück in Eschede, nach dem 11. September 2001, nach dem Amoklauf in Erfurt, während des jüngsten Krieges im Irak nimmt dies unsere Gesellschaft wahr.
Im Rückgriff auf biblische Texte und überlieferte Formen wird Sprachlosigkeit überwunden, werden lösende und versöhnende Worte gefunden, sei es als Ausdruck von Freude und Dankbarkeit, sei es als Ausdruck des Entsetzens über Schicksalsschläge und Katastrophen, über menschliche Bosheit oder die Ambivalenz des technischen Fortschritts. Auch junge Menschen zieht es in solchen Stunden in die Kirchen als Orte, an denen sie in christlicher Symbolsprache Empfindungen ausdrücken können und sich getragen wissen. Ohne Anspruch auf Alleinbesitz des Evangeliums Jesu Christi und mit dem Schatz ihrer Glaubenserfahrung leiht die Kirche dem Entsetzen und Schrecken, der Angst, dem Leid und der Trauer, aber auch der Freude und dem Jubel Form und Sprache.
Halten wir unsere Kirchen wert! Die Synode lädt ein, sich über Grenzen der Kirchenzugehörigkeit hinaus an den gesellschaftlichen Stellenwert der Kirchenräume zu erinnern. Die Kirche muss sich bewusst werden, dass ihr Platz in der Mitte der Gesellschaft ist. Die Synode der EKD tritt dafür ein, diesen Platz mutig zu gestalten. Sie ruft die gesellschaftliche Öffentlichkeit auf, die Gemeinden bei der Wahrnehmung dieser Aufgabe zu unterstützen.
Tagung der 10. Synode der EKD, Leipzig 25. April 2003
|
|
|
Heilige Zeichen, heilige Räume? | 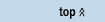 |
|
Kunst und Kirche 2/2000, S. 78-82
Symbole im interreligiösen Kontext
Die Fragestellung, auf welcher Grundlage interreligiös zu nutzende Räume zu gestalten sind, ist vergleichsweise komplex und bei weitem noch nicht im Stadium systematischer Betrachtung.
Der zentrale Aspekt, ob und wie sich die sogenannten interreligiösen Räume von anderen Sakralräumen unterscheiden und in welchen zeichenhaften Elementen ihre Bestimmung erkennbar wird, wurde bislang nur fallweise erörtert.
Ein grundlegendes Symbolverständnis ist dabei hinter den guten Absichten der jeweiligen Initiatoren schwer auszumachen und nur selten wird thematisiert, ob den verwendeten Symbolen in diesem erweiterten Kontext religiöser Erfahrung Sinn und Evidenz zugemessen werden kann.
Die in vielen Gestaltungsansätzen spürbare Ratlosigkeit verwundert daher nicht.
Neue Formen und große Würfe sollen es sein, wo ein längst durchgespieltes Repertoire immer wieder bemüht wird, symbolhafte Grundrisse, metaphorische Deckentragwerke und bedeutungsschwere Bildprogramme werden zitiert, wo längst deutlich geworden sein sollte, dass sie für den heutigen Betrachter nur noch Reminiszenzen ohne Erkenntniswert sind.
Symbole und ihr Kontext „Klare Rede, gemessene Bewegung, strenge Durchgestaltung des Raumes, der Geräte, der Farben, der Töne; alles, Gedanke, Wort, Gebärde und das Bild sind aus den einfachen Elementen des Seelenlebens herausgeformt” – was Romano Guardini 1922 in diesem Satz programmatisch als Basis der christlichen Raumsymbolik zusammenfasste , setzt noch einen einheitlichen Erfahrungshorizont der Nutzer voraus, der heute in mehrfacher Hinsicht nicht mehr gegeben ist:
· im Dialog der Religionen ist die gegenseitige Wahrnehmung – bis auf wenige Ausnahmen – nicht mehr durch die missionarische Perspektive geprägt. Toleranz und gegenseitiges Interesse sind Grundlage des Dialogs.
· sakrale Architekturelemente und liturgieähnliche Rituale haben sich in viele Lebensbereiche multipliziert. Das kirchliche Monopol auf sakrale Räume ist nicht mehr vorhanden.
· Zeichen und Symbole werden in unterschiedlichsten Zusammenhängen verwendet. Postmoderne Zitate, ironische Brechungen oder gezielte Neusetzungen als Mittel von Kunst, Politik und Werbung stehen gleichberechtigt nebeneinander und lassen dem Adressaten eine Vielfalt von Deutungsmöglichkeiten.
Scheinbar unzusammenhängende Zeichen, die die Jungfrau Maria in ihrem Herzen noch zu einer Einheit „bewegen“ (symballein) konnte , bleiben für heutige Betrachter fragmentarische Bruchstücke. Symbole werden in diesem Kontext zu einer frei interpretierbaren Folge von Piktogrammen und Eindrücken. Das Diktum des evangelischen Liturgikers Wilhelm Stählin, dass ein Symbol (im umfassenden Sinne) erkannt werden müsse , erweist sich als unerfüllte Forderung, ebenso wie das Postulat moderner praktisch-theologischer Theorien, dass Symbole die Alltagserfahrungen strukturieren und ihrerseits in Alltagserfahrung transformiert werden können.
Im Gegenteil: Der Umgang mit Symbolen geschieht in den meisten Fällen nur noch auf dem Wege der Annäherung an ursprüngliche Deutungszusammenhänge. Was damit im guten Sinne weitergebracht werden soll, endet nicht selten in einer inhaltlichen Entleerung und Beliebigkeit, die die verwendeten Symbole auf bloße Formelemente reduziert.
Religiöse Symbole in der Architektur Während an kirchlicher Stelle noch die letzten theoretischen Pflichtübungen des entsakralisierten Bauens absolviert werden, ist in der Architektur eine zunehmende Unbefangenheit im Umgang mit religiösen Symbolen zu beobachten.
In der allgemeinen Faszination für das diffus bleibende „Sakrale“ ist die innere Verwandtschaft von ästhetischer und religiöser Erfahrung in unterschiedlichen Formen zum Vorschein gekommen. Die religiösen Implikationen dieser Entwicklung werden im Bereich theologischer Auseinandersetzung mit Architektur nur vereinzelt wahrgenommen.
In einer wunderlichen Mischung aus kritischer Betrachtung und nostalgischer Besitznahme wird die Verwendung sakralisierender Symbole in vielen Bereichen der Architektur als Reihe von Analogien beschrieben. Die meisten Analysen übersehen dabei, dass die Rede vom Schönen und Erhabenen auch bei den Architekten der Moderne einen religiösen Bezug hat und mitnichten unter dem Vorzeichen einer allgemeinen Säkularisierung zu betrachten ist.
Im einzelnen Fall lassen sich die verschiedenen Spielarten von allgemein religiös konnotierten Symbolen, bloßer Architekturmetaphorik und auch im engeren Sinne interreligiös zu nennenden Symbolen – wenn überhaupt – nur schwer voneinander abgrenzen. Für eine Positionsbestimmmung der interreligiösen Symbolik sind deshalb folgende Konstellationen zu betrachten:
1. Kirchenräume, in denen ein interreligiös angelegtes Symbolrepertoire verwendet wird
2. nicht-kirchliche Räume, deren Architektur wesentlich unter Verwendung einer religiösen Symbolik entwickelt wurde, bzw. einen quasi-religiösen Anspruch vertritt
3. Räume mit sogenannter Profannutzung, die aber einen interreligiösen Dialog thematisieren, bzw. für zumindest temporäre interreligöse Nutzungen vorgesehen sind, z.B. in Museen oder Ausstellungen
4. interreligiös angelegte Räume unterschiedlicher Träger, z.B. Flughafenkapellen oder Andachtsräume bei internationalen Organisationen
5. interreligiös, aber in temporärer Aufteilung genutzte Räume
6. Räume für ein interreligöse Nutzung im engeren und eigentlichen Sinne, etwa für gemeinsam ausgerichtete Gebetsstunden oder ähnliche Veranstaltungen
7. Räume in interreligöser Trägerschaft
1.
Abgesehen von Ausnahmen wie den Bauten von Ottokar Uhl, die noch ganz der Programmatik der sechziger Jahre verpflichtet sind, ist bei der Gestaltung kirchlicher Räume seit einigen Jahren eine zunehmende Affinität zu interreligiösen Symbolen zu beobachten. Nachdem das Bild der symbolfreien Gottesdiensträume selbst zum Symbol für das Selbstverständnis einer ortlos gewordenen Kirche wurde, werden jetzt Elementarsymbole wie Kreis, Ellipse oder Spirale in unterschiedlichster Weise angeeignet und sollen die zumeist als Verengung empfundene Konzentration auf dezidiert christliche Symbole überwinden helfen. Zahlreiche Licht-, Farb- und Wasserspiele setzen auf die Selbstevidenz von Symbolen. Wie weit hierbei Anspruch und Wirklichkeit auseinanderliegen, zeigen die symbolhaft gemeinten Spiralen der Berliner Heilig-Kreuz-Kirche und der St. Barbara-Kirche im österreichischen Bärnbach. Während der Besucher in Berlin einen umfänglichen Erklärungszettel mit einer ganzen Reihe exegetischer Besinnungen zur Hand erhält, wird in der österreichischen Dorfkirche ohne Umschweife auf den Gestalter der Spirale verwiesen, den Künstler Friedensreich Hundertwasser, was als Erweis des spirituellen Gehalts offenbar ausreicht. Auch wenn bei ihm die Spirale eine zentrale Rolle spielt und bedeutungsschwer auf höhere Erkenntniswege verweist, die ihrerseits durchaus sinnvolle Assoziationen in einer umgenutzten Berliner Großstadtkirche hervorrufen, bleibt das Symbol als solches reines Dekor. Auch der Anspruch des evangelischen Verantwortlichen für den Expo-Pavillon: „Das Projekt ruft archaisch religiöse Erfahrungen herauf und organisiert sie in christlicher Symbolik“ ist nur im ersten Halbsatz zu bejahen und wird sich in der gebauten Realität wohl selbst falsifizieren. Entsprechende Voruntersuchungen des Marburger Instituts für Kirchenbau verweisen auf die Zweischneidigkeit, das Verhältnis zwischen christlicher Symbolik und allgemein religiöser Erfahrung ohne Vereinnahmungsverdacht auf diese Weise abgrenzen zu wollen.
2.
Neue Formschöpfungen, die sich aus den erweiterten Möglichkeiten der Bautechnik ergaben, wurden seit jeher von den Baumeistern ihrer Zeit als gleichsam religiöse Offenbarung gesehen, von den Raumwundern der Gotik bis hin zur euphorisch begrüßten Eisenarchitektur des neunzehnten Jahrhunderts. Das gilt auch für die Moderne: 1919 hielt der Architekt Erich Mendelsohn einen Vortrag über die technischen Möglichkeiten moderner Architektur, die sich aus den Baustoffen Eisen und Eisenbeton ergeben. Der erste Eisenbinder bedeutet für ihn „nichts Geringeres als das begeisterte Gefühl der Erlösung, mit der im Mittelalter die erste Wölbung die Bauform der Antike überwindet.” Die konstruktiven Zusammenhänge der Bauplanung sind für ihn aber lediglich die erste Komponente der Organisation eines Baues. Dazu kommt eine zweite, nämlich „[die] Befähigung, für die elementaren Voraussetzungen den architektonischen Ausdruck zu schaffen; d.h., die technischen Bedingungen in den Raum zu übertragen, d.h., jene Übereinstimmung zu schaffen, die bei den besten Bauten aller Zeiten die erstaunlichsten Messungswunder ergibt, jene wunderbare Zurückführung der gefühlsmäßigen Vorgänge auf mathematische Größen und geometrische Zusammenhänge...” Damit wird die Architektur, deren Form sich, wie es in den Bauhaus-Manifesten später heißen wird, aus der Funktion heraus entwickeln sollte, zu einer höheren Bestimmung geführt. Sie wird zu ihrer eigenen Aussage und verzichtet fortan auf äußerlich applizierte Sinnzeichen und Symbole, die dem Nutzer und Betrachter klare Hinweise zum Zweck eines Gebäudes geben. Die Wiederentdeckung der nordischen Mythologie und der Aufbau einer neuen Tradition des Deutschtums führten aber bald zu einer Art Gegenreformation, die auch weltliche Gebäude mit religiöser Symbolik überformte. In Folge dieser Spannung wird Architektur selbst zum Symbol, sei es durch Elementarisierung der Bauformen oder durch die räumliche Adaption von Schlüsselsymbolen. Herausragendes Beispiel ist die dekonstruktivistische Variante des Davidsterns beim Jüdischen Museum von Daniel Libeskind. Der religiöse Bezug wird deutlich sichtbar gemacht und teilweise sogar zum interreligiösen Anspruch gesteigert. Auch das Konzept für das – staatliche – Krematorium in Berlin-Treptow orientiert sich, so der Architekt Axel Schultes, an „Gefühl und Härte einer maghrebinischen Moschee“ und stellt sich in den „einzig möglichen Bezug, der uns nach der Enge der Theokratien eines Mose, eines Paulus und eines Mohammed noch geblieben ist: in den Kontrast einer Kosmologie von beseelter, aufgetürmter Erde und der Sonne mit ihrem Licht.“ Ein schwebendes Ei, ähnlich kryptisch wie sein Pendant in einem Gemälde von Piero della Francesca, ist Symbol für die „ewige Wiederkehr ohne Beginn und Ende“. Die Türen erinnern an „jenseitsgläubigere Zeiten.“ Das von Schultes „Orfeum“ genannte Gebäude ist aber auch für jede andere Deutung offen: „man muss das Haus halt mit den Augen hören.“
3.
Vollends aufgehoben wird die Trennung zwischen sakraler und profaner Bestimmung bei einigen Museums- und Ausstellungsprojekten zur interreligiösen Thematik. Die bisher anekdotenhaft kolportierte Andachtshaltung von Museumsbesuchern im Mönchengladbacher Abteiberg von Hans Hollein wird zum Programm. Im Rahmen der Ausstellung „Sieben Hügel – Bilder und Zeichen des 21. Jahrhunderts“, die im Mai dieses Jahres im Berliner Martin-Gropius-Bau eröffnet wird, will der vom Libeskind-Schüler Gerrit Grigoleit gestaltete Raum „Glauben“ Positionen individueller Spiritualität vermitteln. Themen wie die „absonderliche Verbundenheit mit dem Ganzen“ und das „ozeanische Gefühl“ diffuser Religiösität werden als Bruchstücke einer zerbrochenen Kugel – von großen Schalenelementen bis zu einer Vielzahl kleiner Splitter – symbolisiert. Noch weiter geht Jean-Hubert Martin, Generaldirektor des neuen „museum kunst palast“ in Düsseldorf. Im Neubau des Architekten Oswald Maria Ungers sollen „Altäre der Welt" errichtet werden, nicht als Ausstellungsstücke, sondern als vor Ort geweihte Kultstätten der vertretenen Religionen. Gemeinsames Merkmal dieser neuen Art von Räumen ist die Individualisierung und Unverbindlichkeit der Nutzungsmöglichkeiten. Der Besucher kann sich frei bewegen und ist als Konsument unabhängig von liturgischen Zeiten und Personen.
4.
Während sich in den Ausstellungsinszenierungen temporäre Synkretismen bilden, ohne einen überzeitlichen Anspruch zu entwickeln, sind die Programme dauerhaft interreligiös angelegter Räume in der Regel viel zurückhaltender formuliert. Entsprechend vorsichtig wird ein unaufdringlicher Symbolvorrat verwendet, wobei Wert darauf gelegt wird, auf einer dezidiert interreligiösen Grundlage zu arbeiten. Charakteristikum dieser unbehausten Orte ist die Symbolisierung eines sehr kleinen gemeinsamen Nenners, meist über ein meditatives und zugleich transitorisches Grundelement. Ob bei solchen Minimalprogrammen überhaupt von religiöser Nutzung gesprochen werden kann, wäre zu fragen, zumal Ruheräume, Entspannungszonen und ähnliche Orte der Entschleunigung inzwischen zum Standard gewerblicher Gebäude gehören. Insofern sind die Kapellen auf internationalen Flughäfen oder der „Raum der Stille“ am Brandenburger Tor in Berlin vielleicht eine typisch europäische Erscheinung. In Ländern mit kasuell geprägter Religion wie Japan wäre es schwer denkbar, dass es für Menschen „verschiedener weltanschaulicher Herkunft“ „einen Ort geben muss, in dem man sich über alle Unterschiede hinweg im Schweigen treffen kann.“ Mit einem locker gewebten Wandbild soll in diesem merkwürdig aufgeladenen Raum „abstrakt-symbolhaft“ Licht, das die Finsternis durchdringt, angedeutet werden. Die metaphysische Tiefe dieses Makrameecharmes sei dahingestellt. Räume mit einer eigenen Architektursymbolik wie Tadao Andos Kapelle am UNESCO-Gebäude in Paris nehmen dagegen Grundformen aus den Zeiten vor der Entstehung der monotheistischen Weltreligionen wie Pyramide, Zylinder oder Kubus auf. Da dies auch in anderen Architekturbereichen geschieht, entsteht im Ergebnis allenfalls eine Zeichenhaftigkeit, die Toleranz und Gastgeberschaft des Betreibers symbolisiert.
5.
In den nach ähnlichen Prinzipien angelegten Räumen, die darüber hinaus für gemeinschaftliche Gebete und Andachten genutzt werden, ist es üblich, die Symbole der jeweils beteiligten Religionen in das Raumprogramm zu integrieren. Im Andachtsraum des Reichstagsgebäudes ist auf diese Weise die künstlerische Gestaltung durch Günther Uecker das tragende Raumsymbol, während das Inventar der unterschiedlichen religiösen Gruppen bei Bedarf zur Verfügung gestellt und über technische Konstruktionen temporär aktiviert werden kann. Anstelle der Suche nach dem All-Symbol entsteht ein relativ zartes interreligiöses Band durch die Benutzung desselben mehrschichtig angelegten Raumes, dessen Symbolprogramm erst durch die Handlung in Kraft gesetzt wird. Was hier anhand der künstlerischen Qualität –trotz einiger Kontroversen um vermeintliche Übergewichte einzelner Konfessionen – recht gut zu funktionieren scheint, entspricht einem Schlüsselphänomen der heutigen Architektur. Die temporäre „Umwidmung“ vorhandener Räume, eine Abfolge verschiedener Nutzungen für ehemals monofunktional konzipierte Gebäude wird zu einem ständigen Gestaltungsprozess, der auch im laufenden Betrieb fortgeführt wird. In unserem Büro D:4 werden wir vermehrt auf die Entwicklung solcher Konzepte angesprochen. In einer Studie für die Ruine der St. Elisabethkirche in Berlin haben wir Modell entwickelt, das diesen Gedanken konsequent weiterführt. Durch den Einbau eines transparenten Baukörpers, auf dessen Oberfläche unterschiedliche Raumkonstellationen projiziert werden können, ist es möglich, gleichzeitig den ursprünglichen Raum sichtbar zu lassen und eine nutzerspezifische Gestalt darzustellen. Auf hohem künstlerischem Niveau ist eine Fülle von Raumgestaltungen denkbar und es wird zu beobachten sein, ob sich daraus eine verbindliche Folge von Symbolen entwickelt.
6./7.
Eine im engeren Sinne interreligiöse Symbolik ist noch die Ausnahme. Ansätze für einer interreligiöse Trägerschaft sind nur unter anderen religionssoziologischen Bedingungen als in Europa erkennbar, z.B. in Indien. Die dort verwendeten Symbole haben fast ausschließlich kosmologische und anthropologische Bezüge. Die ähnlich gelagerte und diffizile Materie der Entwicklung gemeinsamer Gebetstexte und Gottesdienstformen zeigt , dass es sehr schwierig sein wird, mit vorhandenen Symbolen einen interreligiösen Kontext herzustellen, der nicht durch das Religionsverständnis einzelner Konfessionen dominiert ist. Gemeinsame Andachten oder Gebetstunden finden oft in Kirchen oder anderen nicht interreligiös angelegten Räumen statt. Die unterschiedlichen Traditionen werden dabei recht sinnfällig durch die Kleidung der Liturgen symbolisiert. Abzuwarten bleibt, ob diese mit dem „Parlament der Weltreligionen“ 1893 begonnene Tradition mehr als ein Nebensatz der Religionsgeschichte wird und über einige Modeerscheinungen hinaus eine identitätsstiftende Symboltradition entwickeln kann. Zur Zeit sieht es so aus, dass das sakrale Bauen sich darauf verstehen muss, vor allem eines zu bieten: Räume für alle und keinen.
Marcus Nitschke
ev. Theologe, geb. 1965. Geschäftsführender Partner des Büros D:4 in Berlin, das sich auf Nutzungskonzepte für kirchliche Gebäude spezialisiert hat. Wissenschaftliche Arbeit über Kirchenbau und Stadtentwicklung, Kurator in den Bereichen Architektur und Film.
« zurück
|
|